Saudisches Terrorismusgericht sperrt Twitter-Nutzerinnen für Jahrzehnte weg
Das saudische Regime fürchtet sich sehr vor twitternden Frauen. Eine Mutter muss 34 Jahren in Haft – genau ihr Alter. Und jetzt eine weitere Frau 45 Jahre.
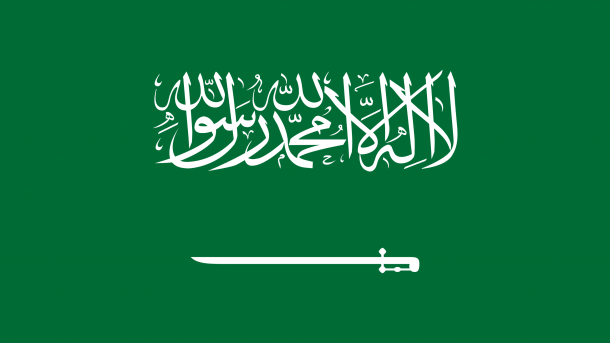
Die Flagge Saudi-Arabiens enthält das islamische Glaubensbekenntnis.
45 Jahre Haft verhängt ein saudisches Spezialgericht für Terrorverbrechen wegen "Herstellung und Speicherung von Material, das öffentliche Ordnung und religiöse Werte beeinflusst" über Nourah bint Saeed al-Qahtani. Das "Verbrechen" der Frau: ein paar regimekritische Tweets. Mit diesen soll sie "das Internet" dazu genutzt haben, das Sozialgefüge Saudi-Arabiens zu zerreißen, meint das Terrorismusgericht.
Erst am 9. August hat das übergeordnete Terror-Berufungsgericht Saudi-Arabiens die Haftstrafe für die Zahnhygienikerin und zweifache Mutter Salma al-Shehab, 34, von acht auf 34 Jahre vervielfacht. Ihr wurden ein paar Retweets zum Verhängnis. Das Berufungsgericht befand, dass acht Jahre Haft unzureichend für "Hemmung und Abschreckung" seien. Sollte al-Shehab die 34 Jahre in einem saudischen Gefängnis überleben, darf die Frau weitere 34 Jahre das Land nicht verlassen. Sie muss also lebenslang in der Monarchie bleiben.
Über beide Urteile berichtet die Menschenrechtsorganisation DAWN (Democracy for the Arab World Now, Demokratie für die arabische Welt) jetzt. DAWN wurde vom saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (Dschamal Chaschukdschi) gegründet. In einem saudischen Konsulat in der Türkei haben saudi-arabische Agenten Khashoggi 2018 gefoltert und ermordet.
DAWN: Bidens Besuch ermutigt Unterdrücker
"Das 45-Jahre-Urteil gegen al-Qahtani, offenbar für einfache Meinungsäußerungen auf Twitter, und nur Wochen nach dem schockierenden 34-Jahre-Urteil gegen Salma al-Shehab, zeigt, wie ermutigt sich die saudischen Behörden Saudi fühlen, dass sie sogar mildeste Bürgerkritik bestrafen", schreibt DAWN-Forscher Abdullah Alaoudh. Der Besuch US-Präsident Joe Bidens bei Kronprinz Mohammed bin Salman in Jeddah im Juli habe die saudischen Machthaber dazu ermutigt, ihre unterdrückerischen Attacken gegen Kritiker zu intensivieren.
Eine Untersuchung Amnesty Internationals aus dem Jahr 2020 zeigt, dass das saudische Sondergericht seit 2011 zur Unterdrückung von Kritik eingesetzt wird. Immer wieder verhängt es schwerste Strafen gegen reine Meinungsäußerungen und friedliche Versammlungen. Es hat sogar mehrere Todesurteile über jugendliche "Täter" verhängt, die schiitische Muslime sind. Schiiten sind in Saudi-Arabien eine religiöse Minderheit.
Gummiparagrafen sind harte Knüppel
Möglich machen diese Gerichtsentscheidungen zwei besonders allgemein gehaltene saudische Gesetze: Ein Computerstrafgesetz stellt unter anderem die Vorbereitung oder Speicherung von Material, das die öffentliche Ordnung, religiöse Werte oder öffentliche Moral beeinflussen könnte, unter Strafe. Und das Anti-Terror-Gesetz definiert selbst die "Störung der öffentlichen Ordnung" oder die "Beleidigung des Rufes des Staates oder seiner Standpunkte" als Terrorismus.
Lesen Sie auch
Zu viel Zensur: Yandex gibt sein Webportal Yandex.ru her
Damit werden grundlegende Rechte schon vor dem Urteil ausgehebelt: Eigentlich dürfen Angeklagte vor ihrem Gerichtsverfahren höchstens sechs Monate in saudischer Haft gehalten werden. Bei Terrorvorwürfen sind allerdings unbeschränkte Haft ohne Gerichtsverfahren zulässig. Die in Großbritannien studierende al-Shehab wurde bei einem Heimaturlaub in Saudi-Arabien Anfang 2015 verhaftet und 285 Tage lang in Einzelhaft gehalten, wobei sie immer wieder langen Verhören unterzogen wurde. Danach musste sie weitere zehn Monate auf die Aburteilung durch das Terrorgericht warten.
Alaoudh wirft Saudi-Arabien Rechtsmissbrauch vor, und fügt hinzu: "Aber das ist nur die halbe Geschichte, weil sogar der Kronprinz solch rachsüchtige und exzessive Urteile nicht erlauben würde, wenn er ernst gemeinte Kritik der USA oder anderer westlicher Regierungen erwarten müsste."
Vier Tage vor ihrer Verhaftung feierte al-Shehab auf Twitter den fünften Geburtstag ihres Sohnes Adam:
(ds)