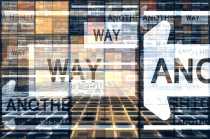Missing Link: Renaissance der Planwirtschaft im digitalen Kapitalismus (Teil 2)

(Bild: metamorworks/Shutterstock.com)
Markt ist smart, und Plan ist Murks, wird gesagt. Dabei wird heute mehr als je zuvor geplant, Algorithmen lassen die unsichtbare Hand des Marktes hinter sich.
In den 1920er Jahren wurde noch eine Debatte darüber ausgefochten, ob geplante Ökonomien überhaupt möglich seien. Der polnische Ökonom Oskar Lange und die russisch-britische Ökonomin Abba Lerner hatten in den 1930er Jahren das Modell einer datengetriebenen Planwirtschaft entwickelt. Sie schlugen vor, zentrale Planungsinstanzen vorzusehen, die in einem ersten Schritt Preise festlegen sollten, und diese dann in einem Try-and-Error-Verfahren so lange anzupassen, bis Engpässe und Überschüsse eliminiert seien – sie beschrieben damit einen kybernetischen Regelkreis.
Die Kybernetik schien die geeignete Wissenschaft, um derlei umzusetzen. "Die Maschine zum Regieren" lautete denn auch der ominöse Titel eines Beitrags für Le Monde aus dem Jahr 1948 [1], in dem der Dominikaner-Pater Dominique Dubarle über "Perspektiven einer rationalen Steuerung menschlicher Prozesse, etwa ökonomischer Phänomene oder einer Evolution von Meinungen" nachdachte. Reale Kalkulationsmaschinen waren noch damals noch nicht in Sicht, was ihn nicht davon abhielt, sich zu fragen: "Könnte man sich nicht eine Maschine vorstellen, die diese oder jene Art von Informationen sammelt, um dann auf Basis der Psychologie eines durchschnittlichen Menschen die wahrscheinlichsten Entwicklungen der Situation zu bestimmen?"
"Der Markt siegt über den Plan"
Die sogenannte Österreichische Schule um die Marktliberalen von Mises und Hayek hatten damals entgegnet, die Menge an benötigter Information für ein solches Modell sein schlicht nicht vorhanden oder nicht zu bewältigen. Daher bliebe allein der Markt übrig als Mechanismus zur Preisbestimmung und zum Matching von Produktion und Konsumption, von Produzenten und Konsumenten, und schon aus informationstheoretischer Sicht notwendig.
Mit dem Untergang der Sowjetunion vor nunmehr 30 Jahren konnte die Österreichische Schule einen späten, aber deutlichen Sieg im Wettstreit der ökonomischen Systeme erringen: "Der Markt", so die verbreitete Rede, hatte über "den Plan" gesiegt. Die Marktwirtschaften westlichen Typs hatten sich als flexibler erwiesen in der Allokation von Ressourcen, als geeigneter, um die Bedürfnisse der Konsumenten zu befriedigen, als dynamischer in der Entwicklung von Innovationen. Siehe auch den Missing Link: Wie die Kybernetik zur Waffe im Systemkonflikt wurde (Teil 1) [3].
Koordination und Kalkulation
Was aber, wenn heute viel mehr geplant wird als jemals zuvor? Wenn heutige Unternehmen nach innen und nach außen bald nichts mehr dem Zufall überlassen?
Der größte Einzelhändler der Welt, Amazon [4], hat zuletzt 280 Milliarden Dollar umgesetzt, das ist das Dreifache des gesamten Bruttoinlandsprodukts der Sowjetunion zur Zeit der Planungsdebatte vor 100 Jahren. Der Handelskonzern Walmart beschäftigt mehr Menschen, als die Alpenrepublik Slowenien Einwohner zählt, verfügt über eigene Flughäfen und Rechenzentren. In der Walmart-Welt werden immense Flüsse an Gütern, Arbeitskraft, Information bei vollständiger Abwesenheit von Marktmechanismen koordiniert und stellt somit eine weltumspannende privatkapitalistische Planungsunternehmung dar. Und das chinesische Pendant Alibaba [5] bewältigte zuletzt an einem einzigen Tag über eine Milliarde Transaktionen – angesichts dieser Ausmaße muten die Fünfjahrespläne der Sowjetunion wie Sandkastenspiele an.
Alibabas ehemaliger Chef und Gründer Jack Ma hat nicht nur den uramerikanischen Traum vom Tellerwäscher zum Millionär, beziehungsweise vom Englischlehrer zum Milliardär gelebt, und das in einem Land, das von einer kommunistischen Einheitspartei regiert wird und sich als sozialistisch betrachtet. Er sieht auch die Rückkehr der Planwirtschaft in greifbarer Nähe, unter kapitalistischen Vorzeichen allerdings. Jack Ma, selbst Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas, prophezeit, in den nächsten 30 Jahren werde die Planwirtschaft ein Comeback erleben [6]: "Wenn wir Zugang zu allen Daten haben, finden wir die unsichtbare Hand des Marktes."
Der Kapitalismus mache selbst Planwirtschaft, so heißt es seit Neustem angesichts dieser Dimensionen – denn, was oft vergessen wird: Spätestens am Werkstor, am Eingang zur IT-Zentrale und beim Ausstieg aus der Chefetage ist Schluss mit Preissignalen, Konkurrenz und der unsichtbaren Hand des Marktes. Unternehmen stellen selbst grandiose Planungsorganisationen dar, und SAP [7] liefert die dazu passende Software, zum Beispiel das Premiumprodukt "SAP digital boardroom", die es dem Management erlaubt, in Echtzeit sämtliche Daten bis zur kleinsten Schraube, Transaktion und Handgriff abzurufen und zur Entscheidungsfindung zu verwenden.
"Planwirtschaft ist nicht nur möglich, sondern bereits überall vorhanden, wenn auch in hierarchischer und undemokratischer Form", behaupten denn auch die beiden Autoren Leigh Phillips und Michal Rozworski. Heutige Konzerne seien nach innen undemokratische hierarchische Planungsorganisationen, sie behandeln ihre Leute so wie die Insassen der Gulags, daher sprechen die beiden auch von den beiden Zwillingsbrüdern undemokratischer Planung, der Sowjetunion und Walmart.
Kapitalistische Planwirtschaft
Aber was ist mit dem Markt als das effizientere System zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage, was ist mit der Konkurrenz, diesem hervorragenden Mechanismus für Innovation, Kundenzufriedenheit und Wettbewerb? Schnee von gestern. "Wettbewerb ist was für Verlierer", sagte der viel zitierte Digital-Investor Peter Thiel. Auch das notorisch unberechenbare Nutzerverhalten wird mithilfe von Big Data und Künstlicher Intelligenz vorhersagbar, falls diese nicht schon durch geeignete Algorithmen von vorneherein in die richtige Richtung gestupst worden sind.
Amazon weiß heute mit großer Wahrscheinlichkeit, welche Bücher ich als Nächstes kaufen werde, nämlich diejenigen, die es mir aufgrund meiner Geschichte vorschlägt. Oder um es mit Georg Klaus Definition einer kybernetischen Maschine auszudrücken: "Die Zustände der Maschine hängen von den Zuständen der Maschine in der Vergangenheit ab." Der Unsicherheit des Marktes begegnen die riesigen Konzerne mit dem KI-gesteuerten Versuch, das künftige Kaufverhalten möglichst genau voraussagen zu können, um zielgenau, personalisiert und schnell den Kunden zu bedienen und der für die Marktwirtschaft notorischen Überproduktion zu entgehen. Aus dem homo oeconomicus ist der homo kyberneticus geworden – der feedback-gesteuerte Nutzer
homo kybernetikus capitalensis
Heute, 70 Jahre nach ihren Anfängen, erlebt die Kybernetik eine Renaissance, und zwar an der Hand der Digitalkonzerne. Mit ihren Plattformen haben sie weltumspannende digitale Ökosysteme entwickelt, deren Spielregeln sie selbst entwerfen und steuern. Die im Namen enthaltene Analogie zu komplexen, nach dynamischem Gleichgewicht strebenden natürlichen Systemen, ist dabei ein deutlicher Hinweis auf deren kybernetischen Charakter. Die Überwindung der vorab für einen anonymen Markt geplanten Massenanfertigung möglich. Produkte können nach individuellem Bedarf erst dann hergestellt werden, wenn eine Nachfrage eingeht: Kapitalismus on demand, die Fertigung der Losgröße eins wird möglich.
Der vernünftige Plan, mit dem der Sozialismus überzeugen zu können glaubte, beispielsweise in Gestalt der berühmten 5-Jahres-Pläne, erscheint angesichts der Vorhersagemaschinen, die das Kapital einsetzt, kurios aus der Zeit gefallen. In den Zeiten digitaler Plattformen, proprietärer Märkte, umzäunter Gärten und digitaler Ökosysteme kommen der Ökonom Viktor Mayer-Schönberger und der Journalist Thomas Ramge zu dem Schluss, dass Daten mittlerweile so reichhaltig und komplex seien, dass sie viel besser als das Preissystem geeignet seien, ökonomische Signale zu liefern. Folge sei ein Art Daten-Postkapitalismus.
Die weltumspannenden Großkonzerne haben ihre interne Planwirtschaft zwar verallgemeinert und digitalisiert, das Steuerungsmoment der gesellschaftlichen Produktion bleibt aber die Maximierung des Profits. Das Betriebsvermögen liegt unverändert in privater Verfügungsgewalt, es ist die Voraussetzung eines Marktes, der das Angebot nur für die zahlungsfähige Nachfrage bereitstellt, unabhängig von den tatsächlich vorhandenen Bedürfnissen. Künstliche Intelligenz, Big Data, Data Mining und KI-Analysen haben zu einem datengetriebenen Vorhersage- und On-Demand-Kapitalismus geführt. Erst mit dem datengetriebenen Plattformkapitalismus unserer Tage ist also der kybernetischen Maschine zum Durchbruch verholfen. Die Rückkopplung von Daten in ein System, das sich dadurch optimiert, stabilisiert und gleichzeitig erneuert und zur kapitalistischen Verwertung beiträgt.
Kybernetischer Sozialismus?
Wie sieht es nun aus mit einer Alternative zu diesem kybernetischen Kapitalismus? Eine Alternative, in der die gesellschaftliche Produktion und Konsumtion nicht mehr über Profitmaximierung gesteuert wäre, eine Alternative, welche kybernetische Steuerungsprozesse nutzt, um möglichst ressourcenschonend und arbeitssparend zu produzieren? Worin unterschiede sich eine solche Alternative von den Amazons, den Walmarts, den Googles und Teslas unserer Zeit? Und stünde ihr das gleiche Schicksal, wie ihren realsozialistischen Vorgängern bevor, ein grandioses Scheitern zwischen Ineffizienz und Armseligkeit? Hat doch der Realsozialismus die Idee der Planwirtschaft gründlich diskreditiert: Nur in der Theorie vernünftig geplant, ressourcenschonend produzierend, Bedürfnisse gerecht bedienend. Die Realität sah anders aus: Schlechte Arbeitsbedingungen, veraltete Technik, keine Rücksicht auf die Umwelt, eine bizarre Koexistenz von Mangel und Verschwendung – dass es keine Kapitalisten mehr gab, änderte nichts daran.
Vom Autor herausgegeben erscheint Ende März der Sammelband „Die unsichtbare Hand des Plans. Koordination und Kalkül im digitalen Kapitalismus [8]“.
(bme [9])
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-5291410
Links in diesem Artikel:
[1] http://www.nanomonde.org/IMG/pdf/Dubarle_1948.pdf
[2] https://www.heise.de/thema/Missing-Link
[3] https://www.heise.de/hintergrund/Missing-Link-Wie-die-Kybernetik-zur-Waffe-im-Systemkonflikt-wurde-Teil-1-5072832.html
[4] https://www.heise.de/thema/Amazon
[5] https://www.heise.de/thema/Alibaba
[6] https://www.globaltimes.cn/content/1051715.shtml
[7] https://www.heise.de/thema/SAP
[8] https://dietzberlin.de/produkt/die-unsichtbare-hand-des-plans/
[9] mailto:bme@heise.de
Copyright © 2021 Heise Medien